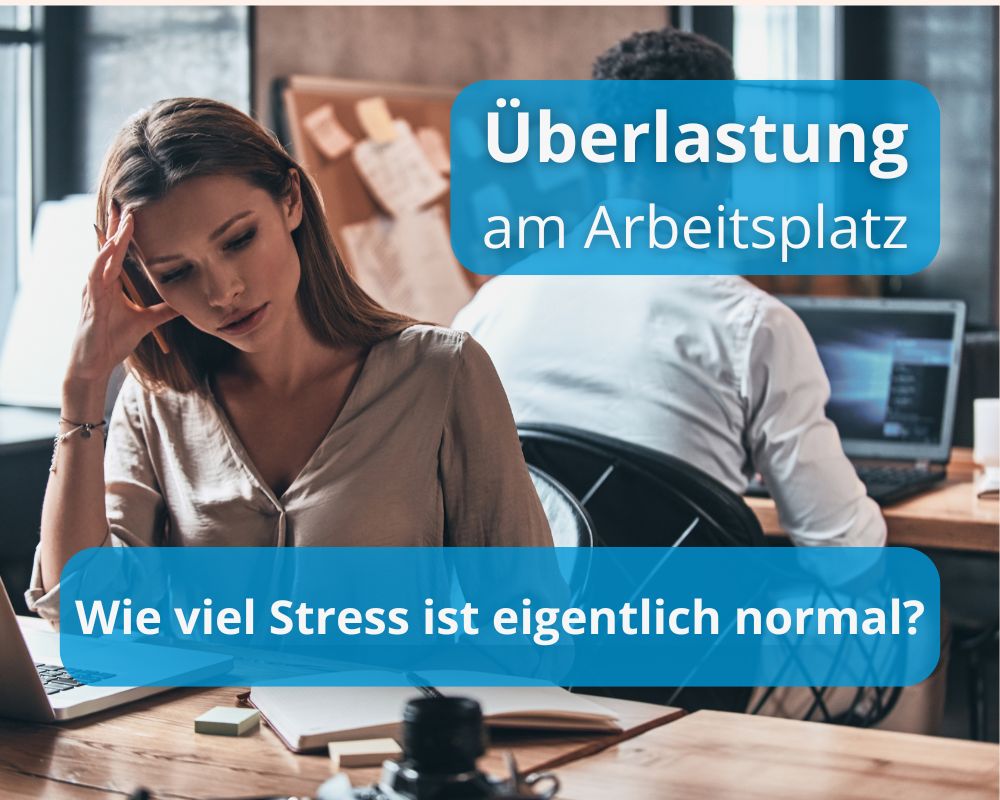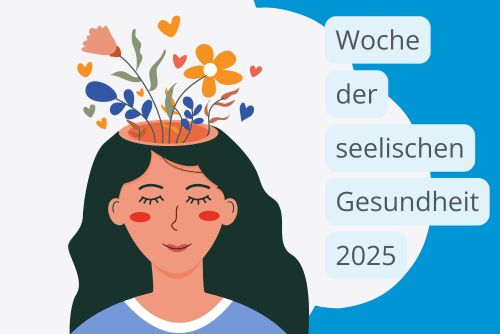Überlastung am Arbeitsplatz: Wie viel Stress ist normal?
Team alfatraining.com | 01. Oktober 2025
Der Arbeitstag hat kaum begonnen, doch das Postfach ist bereits voll, Termine reihen sich aneinander, das Telefon klingelt ununterbrochen und die To-do-Liste wächst schneller, als du sie abarbeiten kannst. Kennst du das Gefühl, bereits erschöpft zu sein, bevor der Arbeitstag überhaupt wirklich begonnen hat?
Wenn solche Belastungen immer wieder auftauchen, du zunehmend gestresst bist und keine Erholungspausen mehr einlegen kannst, dann ist das ein erstes Zeichen für eine Überlastung am Arbeitsplatz. Ignorierst du die Warnzeichen deines Körpers immer wieder, kann dies zu ernsthaften gesundheitlichen Folgen wie einer Burnout- oder Depressionserkrankung führen.
Doch wie viel Arbeitsintensität und Stress ist eigentlich normal und wo liegt die Grenze zur Überarbeitung?
In unserem Beitrag erfährst du, was Überlastung am Arbeitsplatz ist, welche Ursachen sie hat und wie du ihre Anzeichen erkennst. Außerdem bekommst du die besten Tipps, die gegen Überbeanspruchung helfen.

Kurz & knapp
- Überlastung am Arbeitsplatz entsteht, wenn Anforderungen dauerhaft die eigenen Ressourcen übersteigen.
- Symptome: Unter anderem Gereiztheit, Konzentrationsprobleme, Müdigkeit, Schlafstörungen, häufige Infekte.
- Häufige Ursachen: Beispielsweise zu viele Aufgaben, fehlende Pausen, Zeitdruck, Personalmangel, schlechte Organisation oder Führung.
- Was tun bei Überforderung? Pausen bewusst einplanen, Resilienz stärken, Selbstmanagement verbessern, Strukturen im Team optimieren, aber vor allem: die eigenen Muster erkennen.
- Wichtig: Frühzeitig handeln, Unterstützung suchen und Warnsignale ernst nehmen. So kannst du langfristig gesund und leistungsfähig bleiben.
Was bedeutet Überlastung am Arbeitsplatz?
Von einer Arbeitsüberbelastung spricht man, wenn die psychische oder physische Auslastung zu einem Erschöpfungszustand führt, der sich mit mentalen, emotionalen oder körperlichen Symptomen äußert und über einen längeren Zeitraum anhält. Oder anders ausgedrückt: Wenn du dich zunehmend von deiner Arbeit gestresst fühlst und aus dieser Gefühlslage nicht mehr herauskommst.
Bereits 2018 gaben in einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) 22% der Befragten an, nach der Arbeit häufig nicht abschalten zu können. (3) Eine Zahl, die durch die fortschreitende Digitalisierung und die stetig verschwimmenden Grenzen von Belastung und Erholung weiter steigt.
Dabei ist Stress nicht per se schlecht. Wir brauchen ein gewisses Maß davon, um in Bewegung zu kommen und überhaupt einen Antrieb zu haben. Die am häufigsten zitierte Definition von Stress stammt aus dem Jahr 1956 von Hans Selye, für den Stress lediglich „die unspezifische Reaktion des Körpers auf jede Anforderung [ist], die an ihn gestellt wird.“ (1)
Unser Körper schüttet dabei verschiedene Stresshormone aus, wodurch wir leistungsfähig und energiegeladen werden. Diese Reaktion des Körpers ist ein Urinstinkt, der es uns früher ermöglicht hat, vor auftretenden Gefahren des Lebens, wie dem berüchtigten Säbelzahntiger, in Sekundenschnelle die Flucht zu ergreifen oder zu kämpfen (Flight or fight-reaction). Diesen Instinkt der Stressreaktion haben wir auch im Wandel der Zeit beibehalten. (2)
In der heutigen Arbeitswelt haben wir es mittlerweile nur noch selten mit kurzweiligen Stressmomenten zu tun, viel mehr begegnen uns langanhaltende Stressphasen, wie die heiße Phase eins Projekts oder auch die jahrelange Zusammenarbeit mit herausfordernden Kolleg:innen, dauerhaft.
Doch egal, ob wir es nur mit einem kurzen Moment oder einer langen Stressphase zu tun haben, unser Körper kann dies unbeschadet überstehen. Allerdings nur, wenn wir ihm die anschließend benötigten Erholungs- und Regenerationsphasen zukommen lassen. Fallen diese jedoch weg und bleiben wir im Stress-Modus haften, haben wir früher oder später negative Konsequenzen zu erwarten. Wie ein Motor, der ständig mit einer zu hohen Drehzahl gefahren wird, geht auch der Körper bei langfristiger Überlastung kaputt.
Welche Symptome zeigen, dass ich überlastet bin?
Bevor eine Überlastung in schwerwiegenden Krankheiten wie beispielsweise einem Herzinfarkt oder einem Burnout enden, gibt es zahlreiche Anzeichen, mit denen uns der eigene Körper auf unseren zweifelhaften Weg hinweisen möchte. Meist ignorieren wir diese Anzeichen, lenken uns mit Social-Media oder Fernsehen ab und funktionieren weiter. Bis eines Tages, scheinbar unvermittelt, nichts mehr geht und der Körper streikt. Statt uns abzulenken, sollten wir die Signale unseres Körpers wahrnehmen und als Chance sehen, innezuhalten und wieder neue Kraft zu schöpfen.
Warnsignale im Arbeitsalltag:
1. Mentale & emotionale Symptome
Haben wir dauerhaften Stress, reagieren wir oft gereizt und wütend auf die harmlosesten Dinge, sowohl auf der Arbeit als auch im Privatleben. Im Nachhinein können wir uns diese Reaktion oft nicht mehr erklären. Stattdessen folgt ein schlechtes Gewissen, wodurch unser Stresslevel zusätzlich erhöht wird. Kommen wir nicht aus unserem Zustand des anhaltenden Stresses heraus, steigen Reizbarkeit und Wut weiter an, wodurch wir noch empfindlicher auf unser Umfeld reagieren. Es eröffnet sich ein Kreislauf, den wir nicht mehr unterbrechen können.
Gerne ignorieren wir diese neue Verhaltensweise und versuchen weiterhin unsere Aufgaben unbeschadet zu erledigen. Allerdings haben wir das Gefühl, einfach nicht voran zu kommen. Einfache Arbeiten beanspruchen zunehmend mehr Zeit, denn es fällt uns immer schwerer, uns zu konzentrieren. Kleine Fehler schleichen sich vermehrt ein und lassen unser Stresslevel weiter steigen oder nagen sogar an unserem Selbstwertgefühl.
Nach einem anstrengenden Arbeitstag bleibt dann oft kaum Energie für Freunde, Familie oder Hobbys. Statt neue Kraft zu tanken, verbringen wir die Abende erschöpft auf dem Sofa, versuchen, uns von Serien berieseln zu lassen, und merken dabei, dass wir innerlich nicht wirklich zur Ruhe kommen.
2. Körperliche Symptome
Schließlich wird der Körper lauter. Zunächst sind es oft harmlose Verspannungen, die uns am Schreibtisch unruhig werden lassen. Kopfschmerzen treten auf, signalisieren ganz klar, dass etwas nicht stimmt. Statt uns eine Pause zu gönnen, greifen wir häufig zu Schmerztabletten und machen weiter. Schließlich gibt es Routinen, die im Alltag eingehalten werden müssen, und Arbeiten, die es zu erledigen gilt.
Doch unser Körper gibt noch immer nicht auf und beginnt, uns nun auch den Schlaf zu rauben. Wir liegen nachts wach, wälzen uns unruhig im Bett hin und her und fühlen uns am nächsten Morgen erschöpft. Trotzdem stehen wir auf, trinken einen schnellen Kaffee und hetzen zur Arbeit. „Das ist normal“, reden wir uns ein, „schlecht geschlafen hat jeder mal.“ Und so geht es weiter, ohne dass wir wirklich innehalten.
Mit der Zeit wird das Immunsystem schwächer. Erkältungen oder kleinere Infekte treten häufiger auf, und nicht selten sagen wir Sätze wie: „Ich bin ständig krank.“ Doch anstatt die Signale zu hinterfragen, ignorieren wir sie weiterhin. Selbst wenn uns eine Grippe ins Bett zwingt, greifen wir zum Handy oder lassen uns weiterhin vom Fernseher ablenken. Eine wirkliche Erholung bleibt aus. Der Körper macht deutlich, dass etwas nicht stimmt, doch wir überhören ihn und überdecken die Symptome nicht selten weiterhin mit Medikamenten. An den Ursachen ändert das aber nichts.
Ursachen von Arbeitsüberlastung
Wenn wir einmal genau auf unsern Körper hören und hinschauen, wie es uns wirklich geht, ist uns die Ursache schnell klar. Meist sind es zu viele To-dos, die nicht abgearbeitet werden können. Zu viele Aufgaben, die parallel laufen, oder Jobs, die uns keine Freude bereiten. Würden wir mehr auf unsere innere Stimme hören, würden wir vermutlich erst gar nicht an diesen Punkt gelangen. Doch schauen wir uns die Ursachen für eine Überlastung einmal näher an:
1. Fehlende Pausen und Erholungsphasen
Wie bereits erwähnt, ist Stress ist nicht per se schlecht, sondern dient vor allem als Motivator für unser Leben. Doch unser Körper braucht als Ausgleich Pausen und Erholungsphasen, um sich zu regenerieren und seine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Auch Leistungssportler:innen wissen dies und planen bewusste Regenerationszeiten in ihren Trainingsplan ein. Machen sie dies nicht, fallen ihre sportlichen Leistungen ab. Auch unser Arbeitsalltag ist für unseren Körper anspruchsvoll und kostet Energie. Gönne deinem Körper deshalb bewusste Erholungspausen, lerne abzuschalten und schalte dein Handy und Fernseher gelegentlich aus.
Lese-Tipp: Was sind die besten Wege aus dem Stress?
2. Zu hohe Arbeitslast, Multitasking und Zeitdruck
Wenn jeder Tag ein so hohes Arbeitspensum aufweist, dass kaum Zeit zum Durchatmen bleibt, dann sind die eigenen Energiereserven schnell erschöpft. Eine stets zu hohe Arbeitslast sollte keine Selbstverständlichkeit werden. Stattdessen lohnt es sich, einmal bewusst seinen Tag zu betrachten, mögliche Überforderungsfaktoren aufzudecken und bei Bedarf nach Lösungen zu suchen. Was lässt sich verändern? Brauche ich ein besseres Zeit- und Selbstmanagement? Wie lassen sich Arbeitsabläufe effizienter strukturieren und muss ich wirklich an jedem Meeting teilnehmen? Und wie lassen sich Besprechungen durch eine klare Agenda und eine produktive Meetingkultur effizienter gestalten?
Lese-Tipp: 5 Tipps, um eine Besprechung effektiv zu gestalten.
3. Personalmangel und schlechte Organisation
Du erledigst zusätzliche Aufgaben, die gar nicht zu deinem Tätigkeitsbereich gehören? Die fehlende Stelle im Unternehmen wird einfach nicht nachbesetzt? Wenn Stellen unbesetzt bleiben oder Arbeitsabläufe schlecht organisiert sind, hat das direkte Auswirkungen auf den Alltag: Aufgaben stapeln sich, Zuständigkeiten verschwimmen und oft landen Tätigkeiten auf deinem Schreibtisch, die gar nicht in deinen Verantwortungsbereich fallen.
Fehlt es dauerhaft an Personal, bedeutet das für dich nicht nur ein höheres Arbeitspensum, sondern auch eine ständige Verfügbarkeit. Überstunden, zusätzliche Projekte oder das ständige Einspringen für andere werden schnell zur Norm. Was kurzfristig vielleicht noch mit Engagement und Teamgeist aufgefangen werden kann, führt langfristig zu Dauerbelastung und Überforderung.
Eine mangelhafte Organisation verstärkt diesen Effekt. Wenn Aufgaben nicht klar verteilt, Prozesse ineffizient oder Verantwortlichkeiten unklar sind, entsteht Chaos. Das führt nicht nur zu unnötigen Doppelarbeiten und Missverständnissen, sondern auch zu einem Gefühl von Hilflosigkeit und Kontrollverlust.
4. Ungünstige Fehlerkultur oder schlechte Führungskräfte
Fehler zu machen, ist meist kein schönes Gefühl. Doch wenn ich Angst vor gemachten Fehlern haben muss, dann wirkt sich dies auch auf meine Psyche aus. Mein Körper ist konstant in Alarmbereitschaft und hat Stress. Die Furcht, dass die eigenen Fehler enttarnt und Restriktionen folgen könnten, führt zu noch mehr Stress. Durch eine positive Fehlerkultur entsteht für Mitarbeiter:innen ein vertrauensvolles und wertschätzendes Arbeitsklima, das zugleich für den Erfolg des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist. Eng damit verbunden ist auch die Rolle der Führungskräfte. Denn zumeist liegt es an ihren Führungskompetenzen, welches Arbeitsklima sich im eigenen Team ausbreitet, wie mit Fehlern umgegangen wird und ob Mitarbeiter:innen mit Schrecken oder Freude zur Arbeit kommen.
Lese-Tipp: Wie sieht eine positive Fehlerkultur aus? Und was haben Fehler mit Resilienz zu tun?
5. Ständige Erreichbarkeit und mobiles Arbeiten
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten, bieten viele Vorteile für Mitarbeiter:innen. Viele nutzen diese Vorteile, um ihre Work-Life-Balance zu optimieren und alle Aspekte ihres Lebens unter einen Hut zu bringen. Doch schnell ist der Laptop auch im Feierabend ausgepackt, um noch kurz eine Mail zu beantworten oder doch noch am Projekt weiterzuarbeiten. Auch im Urlaub haben wir oft unser Handy dabei und somit den Kontakt zum Büro. Besser ist es, seine Erreichbarkeit einzuschränken und das Handy und den Laptop bewusst abzuschalten.
Was tun bei Überlastung im Job? 7 Tipps gegen die Überforderung am Arbeitsplatz
Kennen wir die Ursachen unserer Überlastung, dann können wir bewusst etwas dagegen tun. Wir geben dir einige Tipps gegen die Überforderung am Arbeitsplatz:
1. Resilienz trainieren
Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit eines Menschen. Das heißt, die Art, wie wir auf stressige Situationen reagieren und wie sehr uns diese aus der Bahn werfen. Menschen mit einer guten Resilienz können eine höhere Belastung aushalten. Deshalb ist es vorteilhaft, sich mit dem Thema der Resilienz auseinanderzusetzen und zu lernen, wie man seine eigene sowie die Resilienz am Arbeitsplatz steigern kann.
2. Pausen und Erholungen einplanen
Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, wie du am besten abschalten kannst? Und wie du dich am besten erholst? Solltest du deinen Feierabend vor dem Fernseher oder dem Handy verbringen und dich trotzdem am nächsten Tag nicht erholt fühlen, dann wird es Zeit, darüber nachzudenken, ob dies wirklich die richtige Entspannungsmethode für dich ist. Alternativ könntest du einen Spaziergang machen, dich sportlich betätigen, dich mit Freunden treffen oder ein neues Hobby beginnen und dich kreativ ausleben.
3. Das eigene Zeit- und Selbstmanagement verbessern
Eine geeignete Selbstorganisation und das richtige Zeitmanagement können den (Arbeits-)Alltag sinnvoll strukturieren. Durch die richtige Priorisierung der eigenen Aufgaben, der bewussten Einplanung von Pausen und bei Bedarf auch das Delegieren von Arbeiten entsteht Ruhe und Ordnung. Dadurch stehst du nicht mehr unter dem Druck, alle Aufgaben zeitgleich und alleine erledigen zu müssen.
Lese-Tipp: Effektive Zeitplanung mit Selbst- und Zeitmanagement.
4. Den Arbeitsplatz optimieren
Eine klare Struktur am Arbeitsplatz ist ein wichtiger Schritt, um Überlastung vorzubeugen. Aufgaben sollten sinnvoll priorisiert und so organisiert werden, dass keine unnötigen Doppelarbeiten entstehen. Dazu gehört auch, bestehende Strukturen kritisch zu hinterfragen und sie bei Bedarf neu zu gestalten. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Kommunikation: Lerne, klar zu benennen, was du aktuell brauchst, was dich in deiner Arbeit behindert und wie man dir helfen kann. In unserem kostenfreien Einführungskurs „Achtsame Kommunikation im Arbeitsalltag“ erhältst du hilfreiche Konzepte und Strategien, um deine Kommunikation wertschätzender und effektiver zu gestalten. So lassen sich Missverständnisse vermeiden, die Zusammenarbeit verbessern und ein respektvolles sowie empathisches Miteinander fördern.
Lese-Tipp: Wie kann ich richtig Feedback geben und kommunizieren was ich brauche?
5. Gute Zusammenarbeit im Team
Eine offene und unterstützende Teamkultur trägt maßgeblich dazu bei, Überlastungen frühzeitig zu erkennen und gemeinsame Lösungen zu finden. Wenn Aufgaben transparent kommuniziert werden, können Strukturen neu gedacht und Arbeitsaufgaben sinnvoll verteilt werden. So entsteht eine Entlastung für alle Beteiligten. Ein zentraler Baustein dafür sind Teambuilding-Maßnahmen, die das Vertrauen stärken und den Zusammenhalt fördern. Sie helfen dabei, das Team zusammenwachsen zu lassen, unabhängig vom eigenen Arbeitsort.
Lese-Tipp: Wie kann Teambuilding auch remote gelingen?
6. Rechte und Unterstützungsmöglichkeiten kennen
Oft fühlen wir uns einer Überlastung hilflos ausgeliefert. Dabei gibt es klare Regelungen und Anlaufstellen, die Unterstützung bieten. So regelt zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz, dass der Arbeitstag in der Regel acht Stunden nicht überschreiten darf und ausreichende Pausen eingehalten werden müssen. Auch die psychische Gesundheit ist Teil des Arbeitsschutzes: Arbeitgeber sind verpflichtet, Belastungen zu erkennen und Maßnahmen dagegen einzuleiten. Wenn du merkst, dass dir alles zu viel wird, sprich zunächst mit deiner Führungskraft. Gibt es einen Betriebs- oder Personalrat, kannst du dich auch an diesen wenden. Ebenso ermöglichen betriebsärztliche Dienste oder externe Beratungsstellen wie Gewerkschaften oder Arbeitsschutzbehörden, dich mit deinen Problemen an sie zu wenden. Dokumentiere deine Überlastung, etwa durch Arbeitszeitnotizen oder konkrete Beispiele. So fällt es leichter, das Gespräch zu suchen und deine Rechte einzufordern.
7. Der wichtigste Tipp zum Schluss: Die eigenen Muster erkennen
Kein Mensch stresst sich freiwillig oder überlastet sich gerne am Arbeitsplatz. Wir alle haben Gründe, warum wir dies tun. Vermutlich hast du viele der vorherigen Tipps bereits gehört, doch bist noch immer im Zustand des „gestresst-Seins“ und auf der Suche nach Lösungen. Daher solltest du dich selbst hinterfragen, welche Gründe dich in diesem Zustand halten und wie du von den bestehenden Mustern lösen kannst. Da Veränderungen nicht einfach sind und sowohl Zeit als auch Kraft kosten, hilft es, sich Unterstützung von außen/extern zu holen. Schon ein Gespräch mit Kolleg:innen kann Aufschluss darüber geben, welche Aufgaben oder Situationen uns überfordern und damit stressen. (4)
Wenn die Überforderung gesiegt hat: Wiedereinstig nach Krankheitsphasen
Manchmal führt Überlastung dazu, dass wir krankheitsbedingt eine Pause einlegen müssen, sei es durch körperliche oder psychische Erschöpfung. Der Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag kann dann herausfordernd sein. Wichtig ist, diesen Schritt nicht allein zu gehen, sondern sich Unterstützung zu holen.
Ein hilfreicher Schritt beim Wiedereinstig ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM), bei dem gemeinsam mit dir, deinem Arbeitgeber und, falls vorhanden, dem Betriebsrat überlegt wird, wie der Wiedereinstieg so gestaltet werden kann, dass er nachhaltig gelingt. Das BEM-Gespräch bietet Raum, deine Belastungsgrenzen offen anzusprechen und konkrete Maßnahmen zu vereinbaren, zum Beispiel eine stufenweise Rückkehr, flexible Arbeitszeiten oder angepasste Aufgabenbereiche.
Möchtest du einen Einblick in dieses Thema bekommen, dann melde dich zu unserem kostenfreien Einführungskurs an und lerne, wie du einfühlsam und respektvoll mit Mitarbeiter:innen umgehst, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind und wie sich BEM-Prozesse erfolgreich gestalten lassen.
Lese-Tipp: Wie kann ein BEM-Gespräch zur betrieblichen Wiedereingliederung gelingen?
Fazit
Überlastung am Arbeitsplatz entsteht nicht von heute auf morgen, sondern ist das Ergebnis einer anhaltenden Unausgeglichenheit zwischen Anforderungen und verfügbaren Ressourcen. Wer die Warnsignale seines Körpers ignoriert, begibt sich auf einen Weg, der zu ernsthaften gesundheitlichen Folgen führen kann. Daher sollten wir die Warnsignale unseres Körpers nicht ignorieren, sondern als Einladung verstehen, unser Verhalten und unsere Muster zu überdenken.
Stress gehört zwar zum Arbeitsleben dazu, doch entscheidend ist, wie du damit umgehst: Indem du bewusste Pausen einplanst, deine Selbstorganisation stärkst und dir Unterstützung holst, schaffst du eine Basis für mehr Gelassenheit und Gesundheit. Auch Arbeitgeber und Teams sind gefragt, Strukturen zu schaffen, die Entlastung ermöglichen und ein Klima fördern, in dem offen über Belastungen gesprochen werden kann.
Sieh die Warnsignale nicht als Schwäche, sondern als wertvollen Hinweis, rechtzeitig neue Wege zu mehr Achtsamkeit, Resilienz und Balance zu beschreiten. So bleibst du nicht nur leistungsfähig, sondern vor allem auch langfristig gesund.
Quellen:
- (1) Selye, Hans: The Stress of Life. New York, 1956. S. 54.
- (2) Kaluza, Antonia J.: Führung und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Wie Führungskräfte ihre eigene Gesundheit und die von Mitarbeitenden stärken können. Managementpsychologie Band 5. Göttingen 2025. S. 17.
- (3) Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Stressreport Deutschland 2019. Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden. Dortmund 2020, S. 149.
- (4) Hillert, Andreas: Stress positiv nutzen. Berlin 2023 S. 88.
Stand der Quellen: September 2025